Industriepumpen : Pumpen sind keine Energiefresser
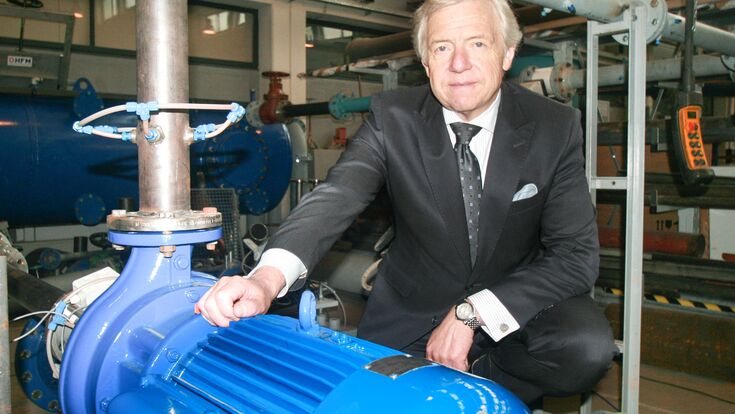
FACTORY: Herr Jaberg, Pumpen wie Strömungsmaschinen sind eine reife Industrie. Recht viel Innovationspotenzial gibt es da nicht mehr – oder doch?
Helmut Jaberg: Vom Grundsatz stimme ich Ihnen da zu. Für mich ist Innovation immer ein großer Sprung nach vorne, das hat diese Industrie hinter sich. Aber inkrementelle Innovationen, also Entwicklungspotenziale, sind noch da. Vor allem was die Zuverlässigkeit solcher Systeme anbelangt. Turbinen haben als Faustwert einen Wirkungsgrad von 95 Prozent erreicht, Pumpen hingegen liegen im Schnitt bei 85 Prozent, viele noch deutlich niedriger. Hier gibt es enormes Potenzial.
Zuverlässigkeit ist der heilige Gral der Branche, steht aber häufig im Konflikt mit Energieeinsparungen, sprich dem Wirkungsgrad von Pumpen. An welchen Schrauben könnte hier gedreht werden?
Jaberg: Für die Betreiber ist eines klar: Der Wirkungsgrad darf in keiner Weise auf Kosten der Zuverlässigkeit gehen. Das hört die Politik nicht gerne, denn damit stehen Energieeinsparungen hinten an. Wir haben viele Abnahmeprüfstände, die die Aufgabe haben, Wirkungsgrade nachzuweisen. Der Grund sind die Ökodesign-Richtlinien (EuP) der EU. Sie hängen wie das Damoklesschwert über den Herstellern. Erreichen sie einen gewissen Wirkungsgrad nicht, droht das Produkt vom Markt genommen zu werden. Aber was nützt mir ein um drei Prozent erhöhter Wirkungsgrad, wenn die Pumpe dann in Teillast nur mehr zehn Prozent der Auslegemenge läuft. Am ursprünglichen Ziel der EU, weniger CO2 durch weniger Energieverbrauch zu erreichen, geht diese Richtlinie glatt vorbei.
Also wird sich an den größten Energiefressern, den Pumpen, auch in Zukunft nichts ändern?
Jaberg: Die gängige Meinung, dass ein Drittel der gesamten erzeugten Energie von Pumpen verbraucht wird, ist falsch. Der Verbrauch spielt sich nicht in der Pumpe ab, sondern in der Anlage. Für die Pumpe ist Energie nur ein Durchlaufposten. Ich sehe das energetische Verbesserungspotenzial vor allem bei der Erstellung solcher Anlagen. Rohrleitungen, Armaturen, Reaktoren, Filter, Wärmetauscher und so weiter – dort könnte man Energie sparen. Jetzt nehmen Sie aber Pumpen schon sehr in Schutz. Wo liegt der Hund wirklich begraben?
Jaberg: Wir stellen fest, dass 90 Prozent aller installierten Pumpen überdimensioniert sind. Nicht nur ein bisschen, sondern um den Faktor 4 bis 10. Wegen der Zuverlässigkeit schlagen Planer oft einige Prozent bei dem zu transportierenden Volumensstrom, der Höhendifferenz und Widerständen drauf. Was sie dabei nicht bedenken ist, dass damit der Rohrleitungswiderstand quadratisch ansteigt. Die Anlage, die das ausführt, weiß aber nichts von diesen Sicherheitszuschlägen. Sie besitzt einen niedrigeren Widerstand. Die Folge: Es wird erheblich zu viel Menge transportiert. Die Betreiber helfen sich dabei mit einer Armatur, die sie ähnlich wie bei einem Heizkörper schließen.
Wenn der Energieverbrauch hier nicht in Relation zu einem Ausfall steht, sehe ich aber nicht das Problem.
Jaberg: Das Ganze geht noch weiter: Denn die überdimensionierten Pumpen laufen oft in Teillast. Dafür sind sie aber nicht gebaut. Dadurch kämpfen die Lager mit sehr hohen radialen Kräften und gehen leicht kaputt. Genauso biegt sich im Tausendstelmillimeterbereich die Pumpenwelle. Das ist sehr wenig, aber auf den Wellen sitzen die Gleitringdichtungen, die wegen der Radialkraft nicht mehr rund laufen. Jeder Betreiber weiß, die Achillesferse der Pumpe sind diese Dichtungen. Würde die Pumpe in ihrem optimalen Betriebspunkt laufen, würden auch die Dichtungen ewig halten. Mit den Gleitringdichtungen wird hier der falsche Hund angebellt. Ich möchte nicht den Herstellern von Dichtungen oder Pumpen das Servicegeschäft vermiesen, aber diese Ausfälle müssten nicht sein.
Der Einsatz von drehzahlgeregelten Pumpen in der Industrie scheidet oft an der Unzuverlässigkeit von Frequenzumrichtern aus. Stimmen Sie dem zu?
Jaberg: Ich halte es für ein Gerücht, dass Frequenzumrichter häufig kaputt gehen. Aber eine alte Regel in der Technik sagt: Was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen. Der Trend wird sich noch weiter verstärken, bedingt durch billige Strompreise. Vor allem bei kleineren Leistungsstufen haben die Hersteller die Konsequenz daraus gezogen und fertigen mittlerweile ihre Frequenzumrichter selbst. Vorreiter ist hier die Gebäudetechnik.
Auf Ihrer Praktikerkonferenz gab es heuer zum ersten Mal einen Vortrag zum Thema Industrie 4.0. Was hat diese Produktionsthematik plötzlich mit Pumpen zu tun?
Jaberg: Für mich hat Industrie 4.0 mit Informationssammlung, -verbreitung und -auswertung zu tun. So wie Google das macht. Auf diese Idee hat mich Stephan Bross von KSB in seinem Vortrag gebracht. Warum nicht über den Betriebspunkt der Pumpe Daten sammeln? Immerhin lässt sich dort vom Volumensstrom über den Widerstand bis hin zu Schwingungen alles sammeln.
Die Pumpe soll zum Systemüberwacher werden?
Jaberg: Eigentlich ist das die Idee, ja. Allerdings stehen die Betreiber dieser Idee äußerst skeptisch gegenüber. Sie lehnen sie geradezu ab. Ein bisschen „Predictive Maintenance“ finden die meisten o.k., aber das ist ein Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was Industrie 4.0 wirklich kann. Ich glaube, Betreiber könnten hier Informationen gewinnen, die sie sich heute gar nicht vorstellen können. Aus vielen Gesprächen weiß ich allerdings, dass sie das gar nicht wollen. Die Prozessüberwachung ist Aufgabe des Leitstands und nicht der Pumpe. Hier ein bisschen offener zu sein, könnte aber nicht schaden. Hier lohnt sich der Vergleich mit Google: Die schöpfen alle unsere Daten und analysieren diese. Das ist uns zwar nicht recht, erlaubt aber offensichtlich enorme Rückschlüsse für das Geschäft. Warum also nicht bei Pumpen und Systemen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Elisabeth Biedermann
